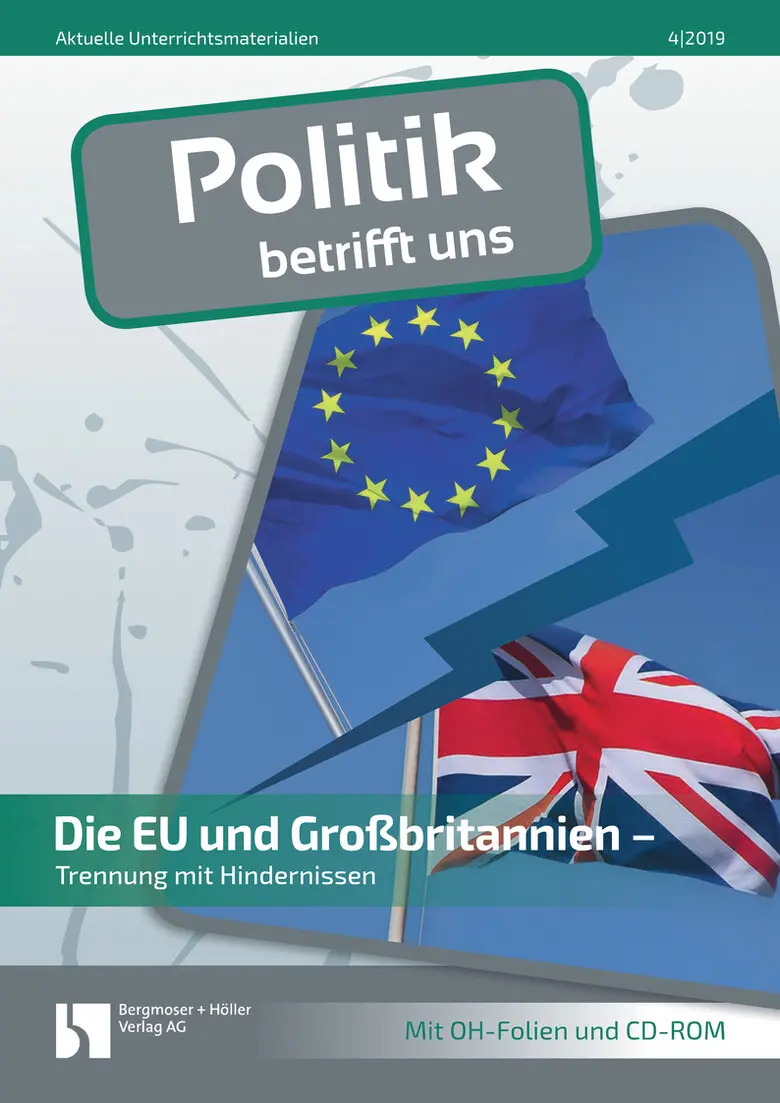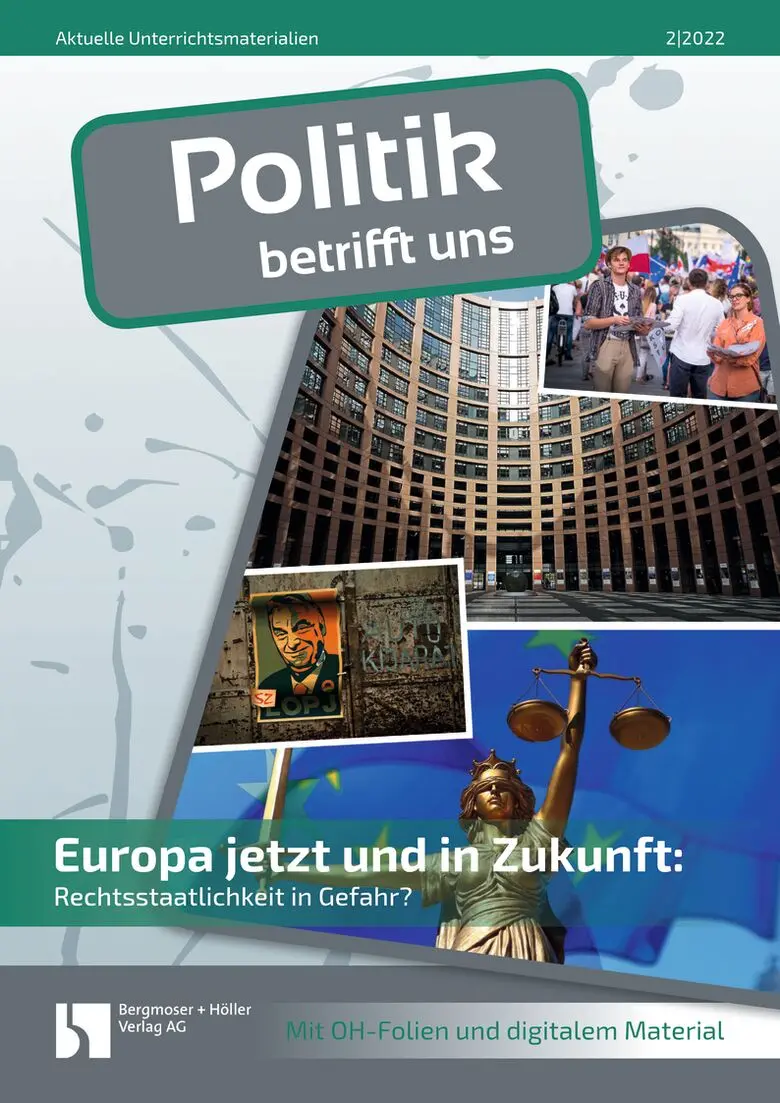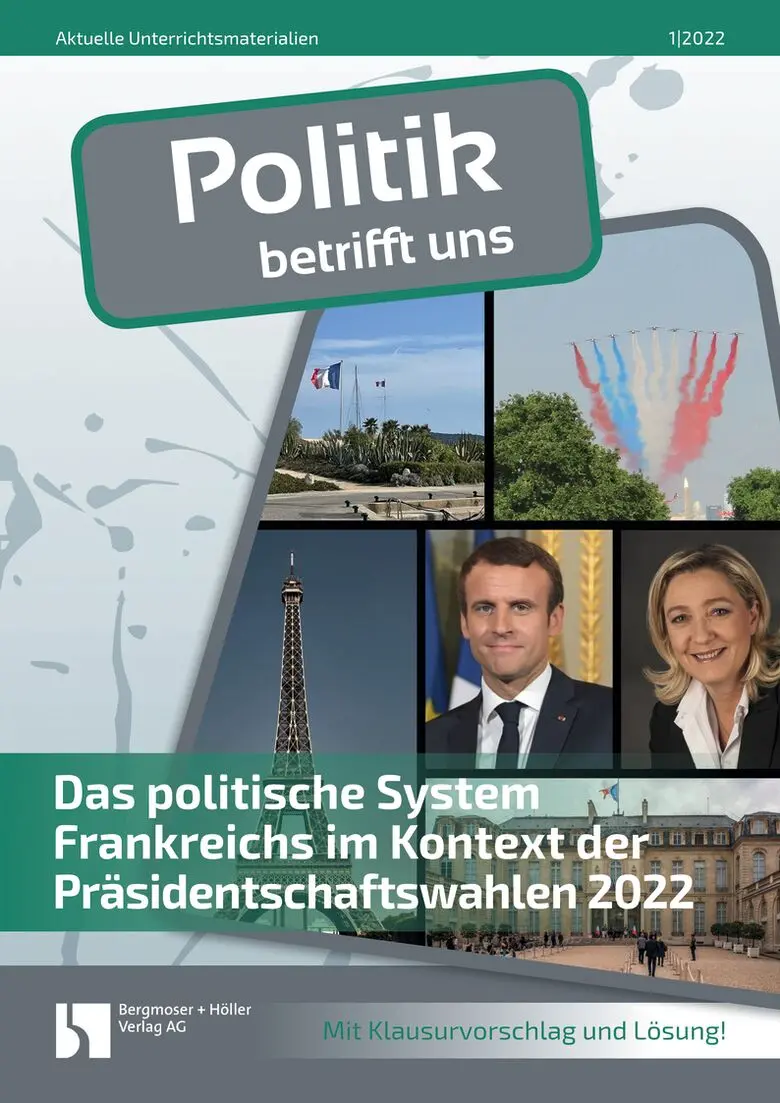Die EU und Großbritannien
Die EU und Großbritannien
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Sachthemen |
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
| Beschaffenheit: | Print Variante: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien *** Digitale Variante: komplettes Heft und CD Inhalte als Download sofort zur Verfügung (PDF, editierbares Word) |
| Seitenzahl: | 28 |
| Produktnummer: | 40-1904 |
34,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
Die Abstimmung über die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens ist ein zentraler Moment in der Geschichte der europäischen Integration. Es wurde erwartet, dass das Ergebnis des Referendums knapp ausfallen würde. Dennoch hatten weder die Finanzmärkte noch die Wettbüros damit gerechnet, dass die Seite, die für den EU-Austritt geworben hatte („Leave“-Seite), gewinnen würde. Boris Johnson droht mit einem harten Brexit. Für die Europäische Union und ihre (inkl. GB) ca. 510 Millionen Einwohner wird 2019 somit zum Schicksalsjahr mit dem Motto „Quo vadis, Europa?“.
Die vorliegende Unterrichtseinheit gliedert sich in drei Teile:
- Im ersten Teil erwerben die Schülerinnen und Schüler zunächst Grundlagenwissen zur Europäischen Union und zum britischen Austritts-Referendum. Hierbei stehen zum einen Motive, geschichtliche Entwicklung und institutionelle Organisation der Europäischen Union im Mittelpunkt.
- Im zweiten Teil analysieren die Schüler/-innen die Interessenkonstellationen in der EU27 und in Großbritannien. Im Anschluss beschäftigt sich die Lerngruppe mit den politischen, vor allem aber auch wirtschaftlichen Konsequenzen des Brexits für beide Seiten.
- Im dritten Teil erweitert die Lerngruppe das bisher Gelernte um die Dimension der Zukunftsfähigkeit. Mit dem Brexit steht für die Europäische Union zum ersten Mal ihre generelle Entwicklung, die bisher aus kontinuierlicher Erweiterung und Vertiefung der Integration bestand, infrage.
Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe
1. Teil: Was ist ... der aktuelle Stand des Brexits?
- M 1.1 Was bedeutet Europa für mich?
- M 1.2 Die Geschichte der Europäischen Union
- M 1.3 Die Erweiterung der Europäischen Union
- M 1.4 Die Organe der Europäischen Union
- M 1.5 Das Brexit-Referendum
- M 1.6 Welche Abstimmungsmuster liegen dem Brexit-Referendum zugrunde?
- M 1.7 Das Austrittsverfahren nach Artikel 50
- M 1.8 Stimmen zum Brexit
2. Teil: Was kann sein? Austrittsszenarien und ihre Folgen
- M 2.1 Wer will was in Großbritannien?
- M 2.2 Wer will was in der EU der 27?
- M 2.3 Der Brexit aus Bürgersicht
- M 2.3 A What citizens think (bilinguales Material zu M 2.3)
- M 2.4 Das Austrittsdokument
- M 2.5 Politische Folgen des Brexits
- M 2.6 EU der 28: Bevölkerung und Wirtschaftskraft
- M 2.7 Mögliche wirtschaftliche Konsequenzen – für die EU und ihre Mitgliedsländer
- M 2.8 Mögliche wirtschaftliche Konsequenzen – für Großbritannien
3. Teil: Was soll sein – zur Zukunft der Europäischen Union
- M 3.1 Mehr Transparenz – der europäische Bürgerdialog
- M 3.2 Entwicklungsperspektiven für die Europäische Union
- M 3.2 E Entwicklungsperspektiven
- K 3.3 Klausurvorschlag