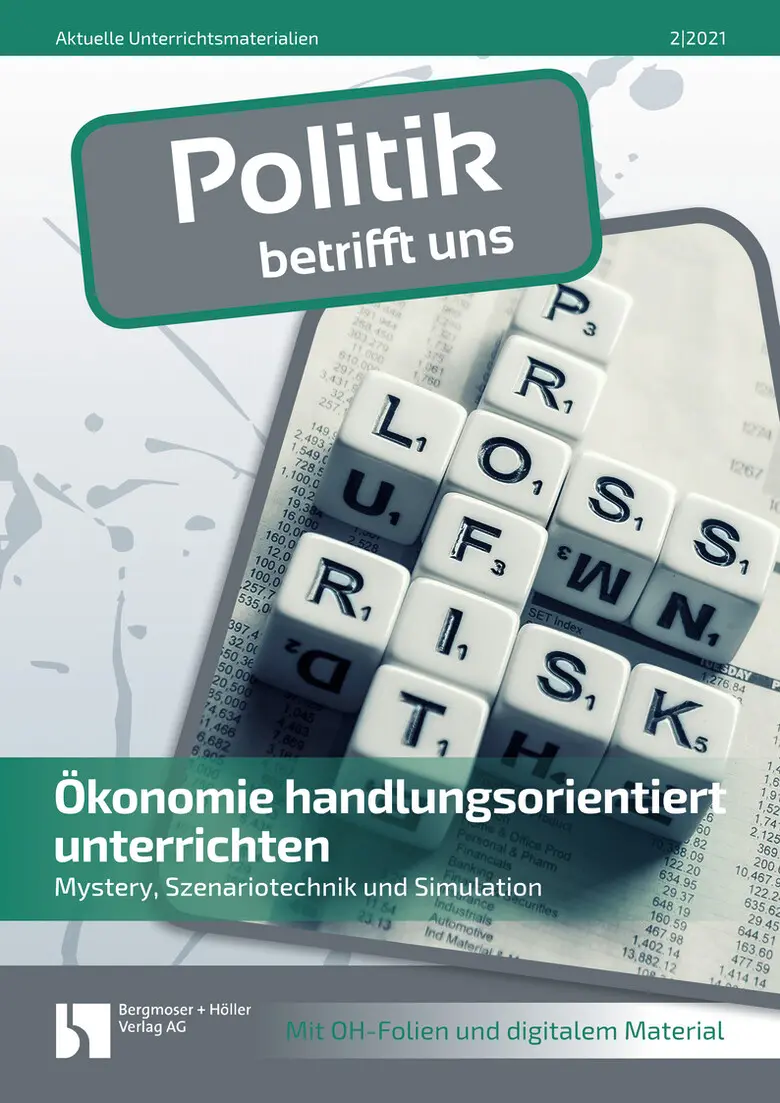Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?
Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Deutschland |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
| Beschaffenheit: | Print: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbiger OH-Folien; Online: Heft (PDF und Word), Bilder (.jpg) |
| Seitenzahl: | 28 |
| Produktnummer: | 40-2106 |
34,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
Die Berufsarbeit nimmt in unserem Leben eine zentrale Bedeutung ein. Von besonderer Relevanz erscheint in diesem Kontext die von Anpassungstendenzen geprägte Modifikation der Arbeitswelt. Im Rahmen dessen bilden fortlaufende Veränderungen der Beschäftigungs- und Produktionsstrukturen ein zentrales Entwicklungsmerkmal moderner Volkswirtschaften. - Im Zuge des industriellen Wachstumsprozesses verlagerte sich z.B. der Schwerpunkt der Wirtschaftstätigkeit zunächst vom primären Wirtschaftssektor zum sekundären Sektor und schließlich zum tertiären Sektor. Ausmaß und Richtung des Strukturwandels werden im Wesentlichen durch Veränderungen der Nachfrage und unterschiedlich rasche Produktivitätsfortschritte in den einzelnen Wirtschaftssektoren bestimmt. Zudem offenbarten uns die arbeitsmarktbezogenen Reaktionen auf die Coronapandemie einmal mehr den schnellen und volatilen Prozesscharakter des Marktes:
"Die Arbeitswelt verändert sich, die Wünsche der Beschäftigten aber auch." Mit dieser Prämisse sollen sich die Schülerinnen und Schüler in diesem Heft auseinandersetzen.
Die vorliegende Unterrichtseinheit gliedert sich in vier Segmente. In der Gesamtbetrachtung widmet sich das Heft dem Verstehensprozess wirklichkeitsbezogener Strukturen und Prozesse, hinsichtlich der Vermittlung gesellschaftswissenschaftlich relevanter Erkenntnisse mit Bezug auf die Arbeitsmarktentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und trägt somit in besonderer Weise zur Ausgestaltung eines Orientierungs-, Deutungs-, Kultur- sowie Weltwissens der Schülerinnen und Schüler bei.
- Im ersten Teil erarbeiten die Schülerinnen und Schüler maßgebliche Entwicklungsprozesse in der Wirtschaftsstruktur moderner Volkswirtschaften im Kontext der Schwerpunktverlagerung der Wirtschaftstätigkeit vom primären über den sekundären, hin zum tertiären Sektor und können dementsprechend den wirtschaftlichen Strukturwandel mit Bezug auf die Begriffe "Industriegesellschaft", "Dienstleistungsgesellschaft", "Tertiärisierung des sekundären Sektors" und "Digitalisierung" beschreiben und erörtern.
- Im zweiten Teil erkennen, erläutern und beurteilen die Lernenden Entgrenzung, Verdichtung, Digitalisierung und Mobilität als grundlegende Entwicklungstendenzen der modernen Arbeitswelt.
- Nach dem Blick auf den zurückliegenden Entwicklungsprozess sowie auf die aktuelle Ausgestaltung des Arbeitsmarktes bezieht sich der dritte Teil dieses Heftes auf die Anforderungen und Erwartungen, die der Markt zukünftig an Arbeitnehmer/-innen und Arbeitgeber/-innen stellen wird. Die Schülerinnen und Schüler erschließen, welche schulischen, sozialen und fachlichen Qualifikationen sie individuell als konkurrenzfähige Bewerber/-innen am Arbeitsmarkt besitzen bzw. entwickeln müssen.
- Der vierte Teil umfasst eine für die Oberstufe/ Qualifikationsphase geeignete Klausur mit dem Schwerpunktthema Ausprägung und Folgen von Arbeitslosigkeit.
Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe
1. Teil: Der Wandel unserer Arbeitswelt
- M 1.1 Entwicklungsprozesse in der Wirtschaftsstruktur moderner Volkswirtschaften
- M 1.1.1 Wirtschaftsstruktur im Wandel
- M 1.1.2 Zur Person: Jean Fourastié
- M 1.2 Veränderung der Arbeitswelt am Ende des 20. Jahrhunderts
- M 1.2.1 Arbeitswelt im Wandel
- M 1.2.2 Wortspeicher (Planwirtschaft/Rationalisierung)
- M 1.3 Der Weg in die Dienstleistungsgesellschaft
- M 1.3.1 Was Arbeit für uns bedeutet
- M 1.4 Verlagerung der Beschäftigungsschwerpunkte
- M 1.4.1 Veränderung der Erwerbstätigenstruktur
- M 1.5 Methodenkarte: Analyse von diskontinuierlichen Texten
- M 1.6 Matrix: Was Arbeit für uns bedeutet
2. Teil: Wie wir in Zukunft arbeiten: Flexibel, digital und entgrenzt?
- M 2.1 Flexible Gestaltung der Arbeitszeit – Bundestagsrede von Beate Müller-Gemmeke, Bündnis 90/Die Grünen
- M 2.2 Flexible Arbeitszeitformen sind heutzutage auf unserem Arbeitsmarkt Realität – Bundestagsrede von Jana Schimke, CDU
- M 2.3 Ergänzende Videobeiträge der Bundestagsdebatte zur Zukunft der Arbeit
- M 2.4 Der Blick durch die Lupe: Pläne der Parteien in der Arbeitsmarktpolitik (Bundestagswahl 2021)
- M 2.5 Hilfekärtchen Urteilsbildung (Kriterien und Perspektiven)
3. Teil: Ein Blick in die Zukunft: Anforderungen und Erwartungen an eine moderne Arbeitswelt
- M 3.1 Wie die Arbeitswelt nach Corona aussehen wird
- M 3.2 Modelle flexibler Arbeitszeitgestaltung
- M 3.3 Diese Kompetenzen sind in der Post-Corona-Ära auf dem Arbeitsmarkt gefragt
- M 3.4 Karikatur: Industrie 4.0 human gestalten
- M 3.5 Ursachen von Arbeitslosigkeit in Deutschland
4. Teil: Klausurvorschlag und Erwartungshorizont
- M 4.1 Klausurvorschlag
- M 4.2 Erwartungshorizont