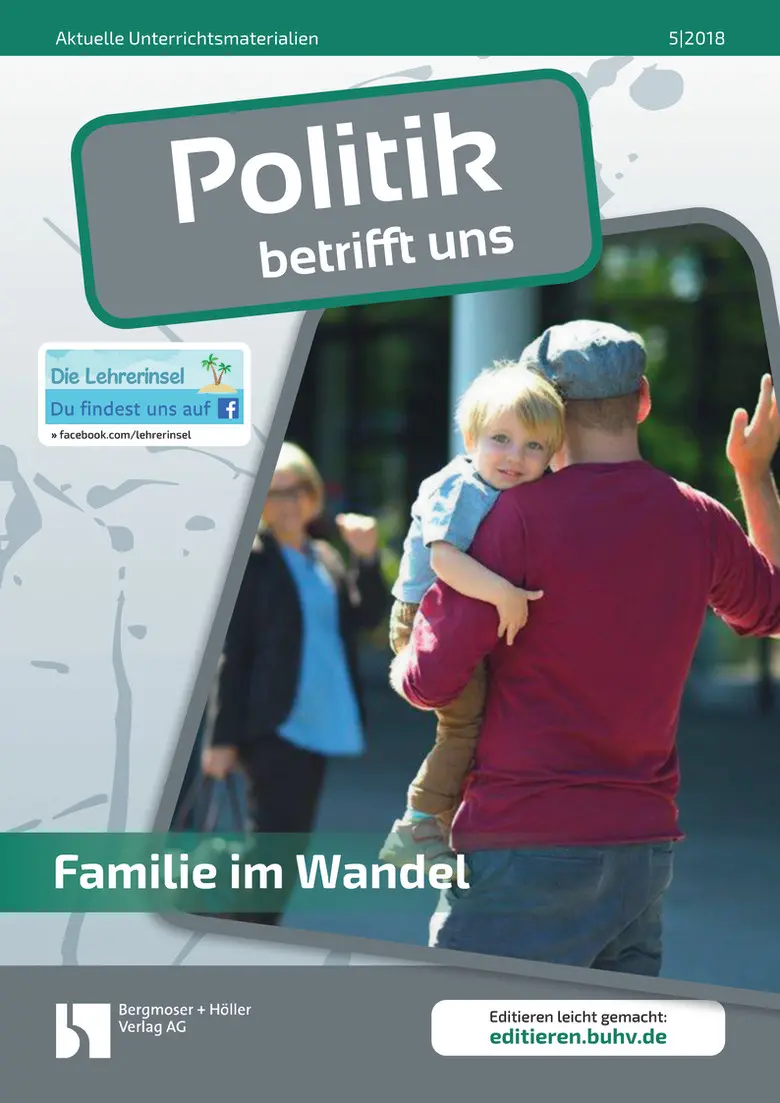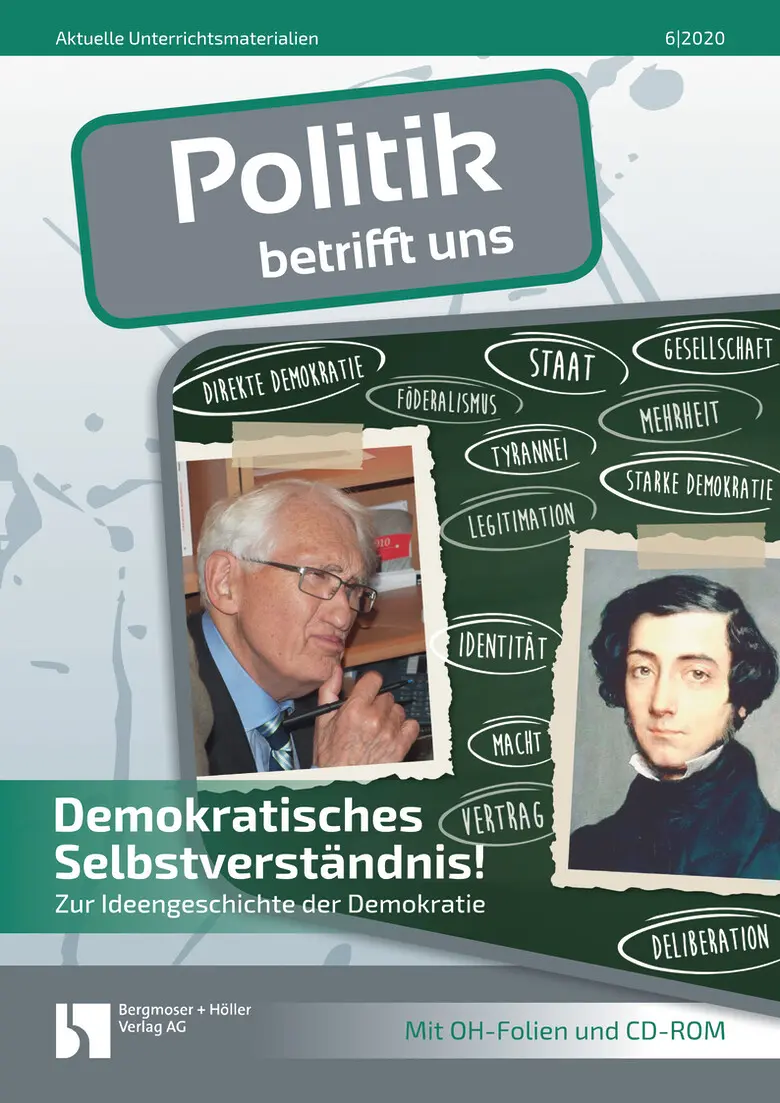Familie im Wandel
Familie im Wandel
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Lebenswelten von Jugendlichen , Sachthemen |
| Erscheinungsjahr: | 2018 |
| Beschaffenheit: | Print Variante: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien *** Digitale Variante: komplettes Heft und CD Inhalte als Download sofort zur Verfügung (PDF, editierbares Word) |
| Seitenzahl: | 28 |
| Produktnummer: | 40-1805 |
34,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
In der Ausgabe „Familie im Wandel" werden verschiedene alte und neue Familienformen sowie die Rollenverteilung innerhalb der Familie beleuchtet. Hinzu kommt, dass die unterschiedlichen Erziehungstypen genauer analysiert und erklärt werden. Ihre Lerngruppe setzt sich darüber hinaus mit den Begriffen Mutter- und Vaterrolle auseinander sowie mit der Gleichberechtigung innerhalb der Familie.
- Im ersten Teil wird der Begriff der Familie präziser erläutert und definiert, um die Schülerinnen und Schüler mit dem neuen Thema vertraut zu machen und ihr Interesse zu wecken.
- Im zweiten Teil analysiert die Lerngruppe zunächst die gesellschaftliche Entwicklung und die verschiedenen Erziehungsstile genauer.
- Im dritten Teil beurteilen ihre Schülerinnen und Schüler die Familienpolitik sowie die staatlichen Förderungssystemen kritisch.
- Im abschließenden vierten Teil sollen die Schülerinnen und Schüler sich mit der Familienpolitik innerhalb der EU befassen. Außerdem sollen die Jugendlichen beurteilen, welche zukünftigen Herausforderungen in der Familienpolitik erwartet werden.
Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe
1. Teil: Familie – eine private Angelegenheit
- M 1.1 Was bedeutet Familie für mich?
- M 1.2 Was bedeutet der Begriff „Familie“?
- M 1.3 Familienformen im Wandel?
2. Teil: Familie – Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen und Wegbereiter für die Poltik
- M 2.1 Foto: „Eltern heute“
- M 2.2 Eltern heute – Väter
- M 2.3 Eltern heute – Mütter
- M 2.4 Erziehung – Stile und aktuelle Herausforderungen
- M 2.5 Rushhour des Lebens
- M 2.6 Scheidungskinder in Wechselmodellen
3. Teil: Familie – politische Angelegenheit und Wegbereiter für gesellschaftliche Entwicklungen
- M 3.1 Wechselbeziehung zwischen öffentlicher Meinung und politischen Reformen
- M 3.2 Familie im Grundgesetz
- M 3.3E Parteipositionen zur Familienpolitik
- M 3.4E Politische Verortung der Parteien bezüglich der Familienpolitik
- M 3.5E Widersprüche in der Großen Koalition – welchen Ausweg gibt es?
- M 3.6 Karikatur: „Familienstreit“
- M 3.7 Staatliche Familienförderungssysteme – Teil 1
- M 3.8 Staatliche Familienförderungssysteme – Teil 2
4. Teil: Familie – wohin des Weges?
- M 4.1 Herausforderungen von morgen
- M 4.2 Familienpolitik – eine interdisziplinäre Angelegenheit
- M 4.3 Unternehmerische „Familienpolitik“
- M 4.4E Familienpolitik in der EU – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
5. Teil Klausurvorschlag
6. Teil Aktuell
- M 6.1E Armutsgefährdete Alleinerziehende – Was ändert daran der Unterhaltsvorschuss?