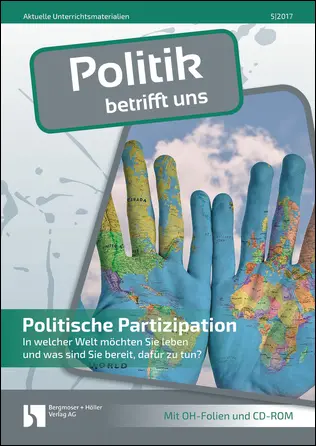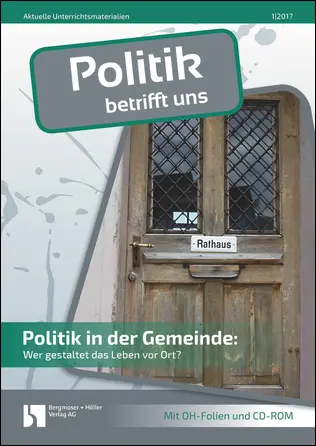Politische Partizipation
In welcher Welt möchten Sie leben und was sind Sie bereit, dafür zu tun?
Politische Partizipation
In welcher Welt möchten Sie leben und was sind Sie bereit, dafür zu tun?
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Deutschland , Lebenswelten von Jugendlichen , Sachthemen |
| Erscheinungsjahr: | 2017 |
| Beschaffenheit: | Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien |
| Seitenzahl: | 34 |
| Produktnummer: | 40-1705 |
Online
29,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
Produktinformationen "Politische Partizipation"
In welcher Welt möchten Sie leben und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Aufgrund unseres politischen Systems können wir relativ leicht unsere Gesellschaft mitgestalten, allerdings nutzt kaum ein Jugendlicher noch diese Chance.
Diese Ausgabe befasst sich mit der Frage, warum fehlende politische Partizipation entstanden ist und wie man dieser entgegenwirken kann.
Die vorliegende Unterrichteinheit ist in drei Teile gegliedert, die sich mit Erklärungsansätzen und Lösungswegen zur politischen Partizipation beschäftigt.
Diese Ausgabe befasst sich mit der Frage, warum fehlende politische Partizipation entstanden ist und wie man dieser entgegenwirken kann.
Die vorliegende Unterrichteinheit ist in drei Teile gegliedert, die sich mit Erklärungsansätzen und Lösungswegen zur politischen Partizipation beschäftigt.
- Der erste Teil ist als methodische Zukunftswerkstatt konzipiert, in der die Missstände aus Sicht der Lerngruppe positiv umgewandelt werden sollen.
- Der zweite Teil stellt verschiedene Möglichkeiten der Partizipation vor. Hier werden auch konkrete Beispiele für erfolgreiche politische Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Vorbild vorgestellt.
- Der dritte Teil befasst sich mit der Frage, wie die politische Partizipationsbereitschaft Jugendlicher gefördert werden kann - dieses ist wichtig für unser politisches System, die Demokratie.
Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe
1. Teil: In welcher Welt möchten Sie leben?
- M 1.1 Wenn mich etwas stört, muss ich das auch sagen
- M 1.2 Sagen Sie „nein“!
- M 1.3 Was mich an der Welt stört
- M 1.4 Sagen Sie „nein“! – Leichter gesagt als getan?
- M 1.5 Es ist wichtig, seinen Beitrag zur Verbesserung der Welt zu leisten
- M 1.6 Wenn ich uns eine bessere Welt gestalten könnte, wäre diese ...
2. Teil: ... und was sind Sie bereit, dafür zu tun?
- M 2.1 Eine Karikatur
- M 2.2 Schüler engagieren sich
- M 2.3 Unsere Schule soll besser werden
- M 2.4 Akteure und Argumente im Schulalltag
- M 2.5 Mitmachen beim Jugendgemeinderat
- M 2.6 Liebes Facebook, ...
- M 2.7 Demonstration
- M 2.8 Platz da
- M 2.9 Film eines kleinen Jungen
- M 2.10 Hubertus Koch – Ein Film eines kleinen Jungen
- M 2.11 JUGEND RETTET – wir übernehmen Verantwortung
- M 2.12 Bidder 70
- M 2.13 Alexander Ebert: „Let’s Win“
3. Teil: Partizipation und Demokratie
- M 3.1 Studie zur politisch-gesellschaftlichen Teilnahme Jugendlicher
- M 3.E Studie zur politisch-gesellschaftlichen Teilnahme Jugendlicher
- M 3.2 Politische Partizipation – Vielfalt und Intensität
- M 3.3 Charakteristika von Demokratie
- M 3.4 Demokratie im Modell
- M 3.A1 Partizipation im Grundgesetz
- M 3.A2 Brauchen wir mehr direkte Demokratie?