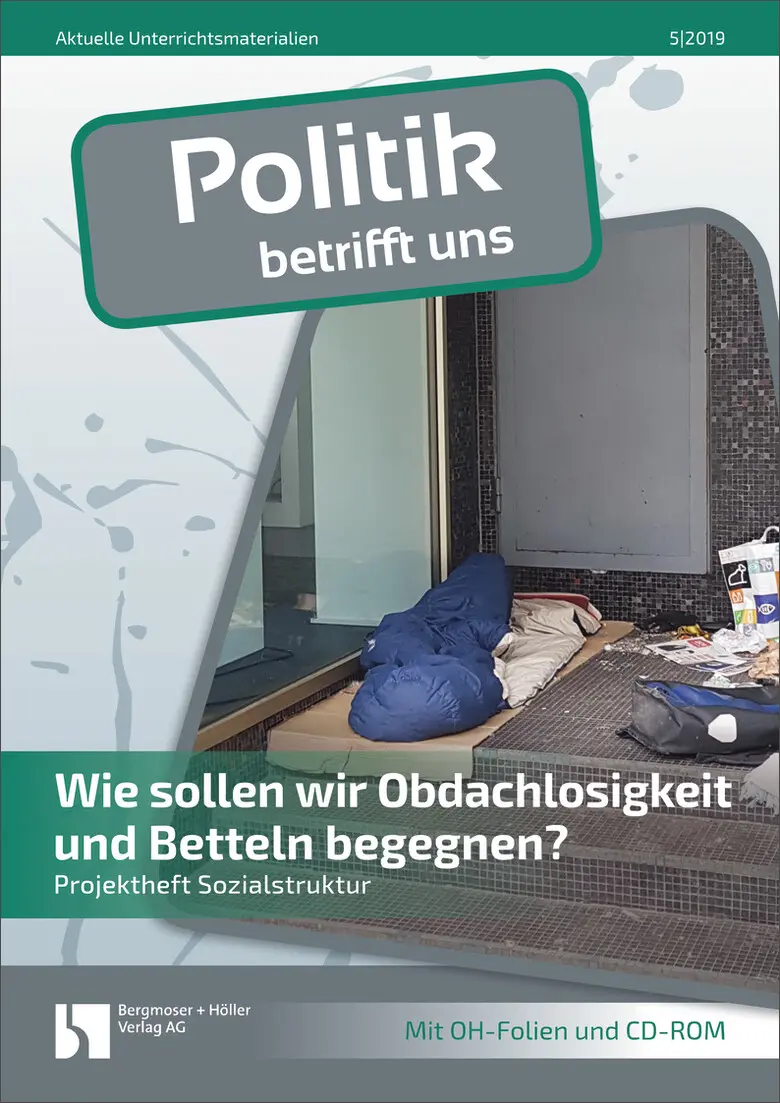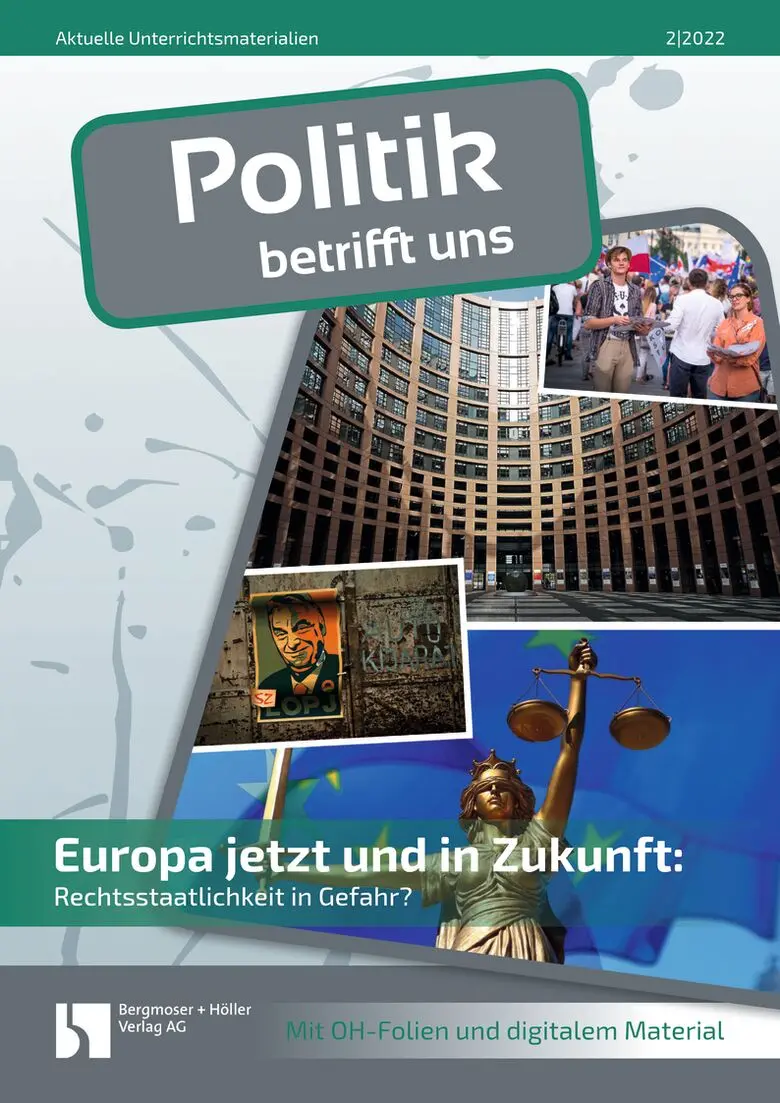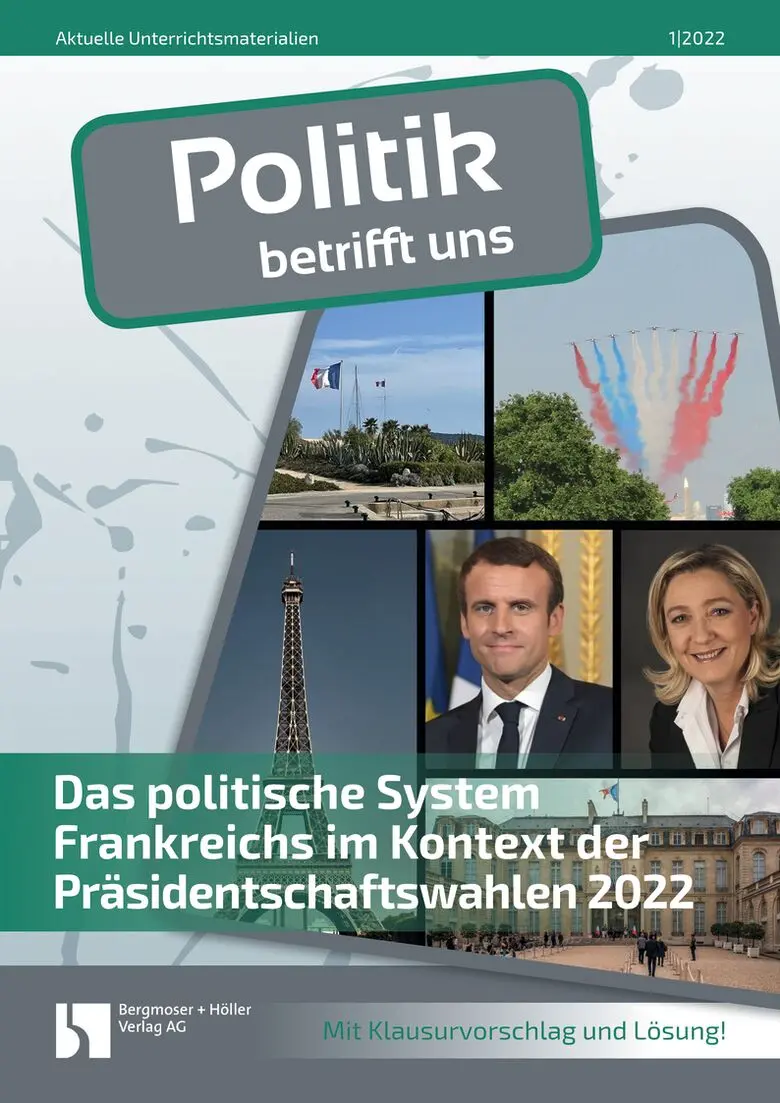Wie sollen wir Obdachlosigkeit und Betteln begegnen?
Wie sollen wir Obdachlosigkeit und Betteln begegnen?
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Deutschland , Lebenswelten von Jugendlichen , Sachthemen |
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
| Beschaffenheit: | Print Variante: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien *** Digitale Variante: komplettes Heft und CD Inhalte als Download sofort zur Verfügung (PDF, editierbares Word) |
| Seitenzahl: | 28 |
| Produktnummer: | 40-1905 |
Online
29,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
Produktinformationen "Wie sollen wir Obdachlosigkeit und Betteln begegnen?"
Armut ist in Deutschland oft unsichtbar. In der Begegnung mit Bettlerinnen und Bettlern sowie Obdachlosen bekommt sie dagegen ein Gesicht.
Gebe ich hier Geld? Oder etwas anderes? Die vorliegende Einheit hat das Ziel, den Blick der Schülerinnen und Schüler auf einen Bereich der Gesellschaft zu lenken, der sonst eher übersehen wird.
- Der erste Teil schlägt eine Brücke zwischen der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und der Welt Obdachloser. Obdachlose kommen zu Wort und die Sprachlosigkeit zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen wird direkt thematisiert.
- Der zweite Teil stellt mögliche Lösungsansätze vor, wie beispielsweise Bettlern Geld zu geben und sozialer Wohnungsbau. Dieser Teil dient vor allem dem Training der Urteilskompetenz.
Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe
1. Teil: Was ist … Obdachlosigkeit in Deutschland?
- M 1.1 Wenn ich einen Obdachlosen sehe …
- M 1.2 Ist das Betteln?
- M 1.3 Bettler – Wohnungsloser – Obdachloser – Penner
- M 1.4 Obdachlosen begegnen
- M 1.5 Obdachlose berichten
- M 1.6 Miteinander ins Gespräch kommen – das Interview als Methode
- M 1.7 Was bedeutet es, obdachlos zu sein?
- M 1.8 Warum werden Menschen obdachlos?
- M 1.9 Ist Wohnungslosigkeit nur ein Randphänomen?
- M 1.10 Obdachlosigkeit im Modell
- M 1.11 Das Problemmodell
- M 1.12 Fallen Obdachlose durch unser Analyseraster?
- M 1.13 Sollte Obdachlosen geholfen werden?
- M 1.14 Wer sollte Obdachlosen helfen?
- M 1.15 Muss der Staat sich um Obdachlose kümmern?
- M 1.16 Solidarität und Subsidiarität als Grundprinzipien des deutschen Sozialstaats
- M 1.17 Dürfen „die“ das überhaupt?
- M 1.18 Bettelbanden in den Medien
- M 1.19 Internetquellen prüfen
- M 1.20 Bettelbanden aus der Sicht von Wohlfahrtsverbänden und polizeilicher Statistik
2. Teil: Was ist möglich? Wie kann Obdachlosen geholfen werden?
- M 2.1 … unless you’re helping them up
- M 2.2 Soll ich Bettlern Geld geben?
- M 2.3 Die goldene Regel
- M 2.3 E Der kategorische Imperativ
- M 2.4 Das muss auch mal gesagt werden …
- M 2.5 Das Konfliktmodell
- M 2.6 Soll das Betteln in Innenstädten verboten werden?
- M 2.7 Wie ich Obdachlosen helfen würde
- M 2.8 Wie der Staat Obdachlosen hilft
- M 2.9 Sollen Gemeinden ein Baugebot erlassen?
- M 2.10 Der Einzelne – Vereine und Verbände oder der Staat? Wer hilft Obdachlosen wirklich?
- M 2 A Klausur: Sollen Obdachlosenzeltlager geräumt werden?