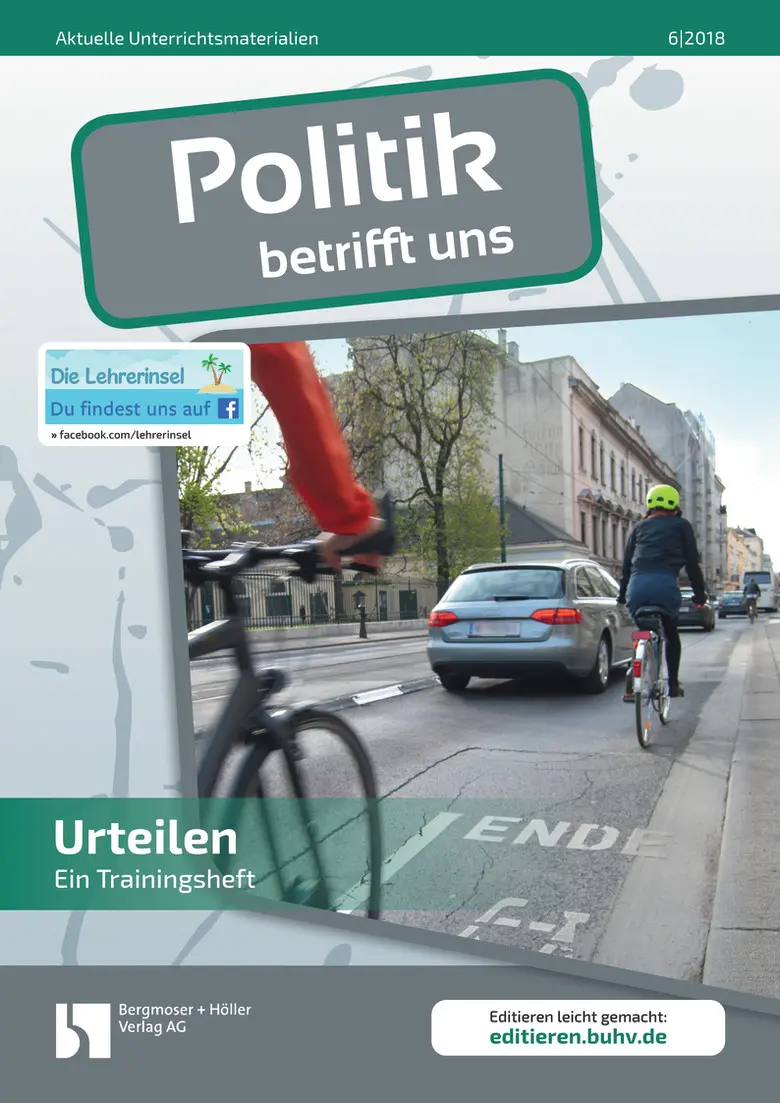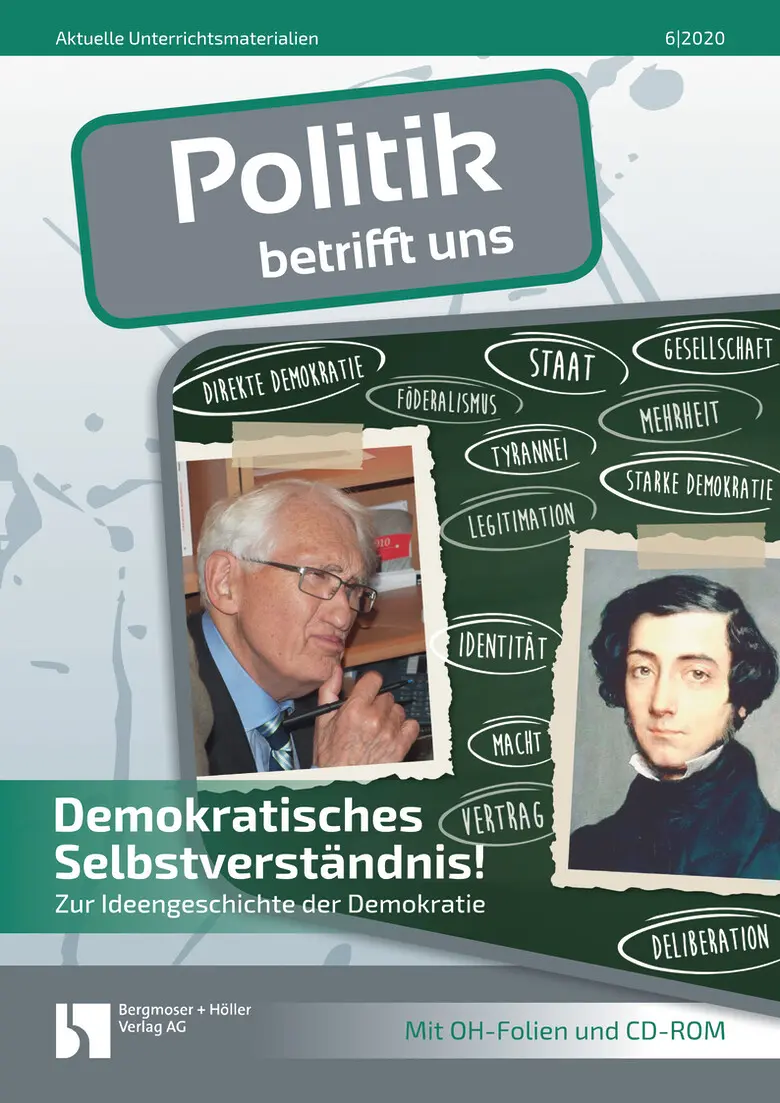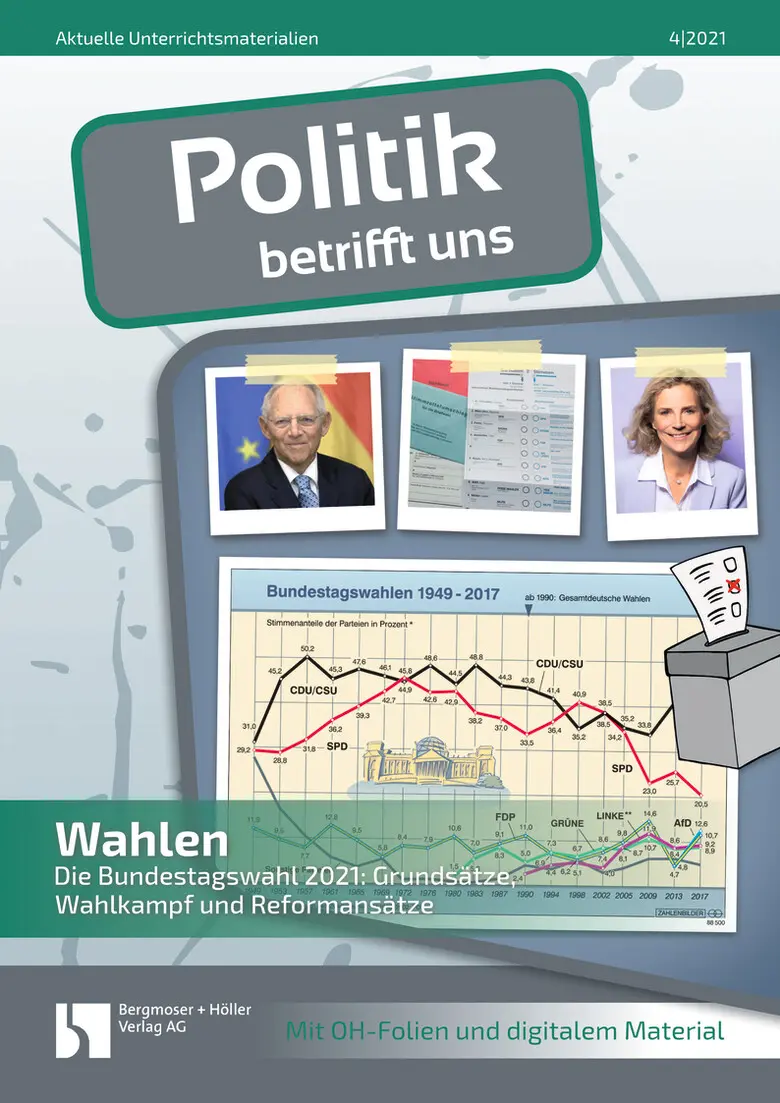Urteilen
Urteilen
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Lebenswelten von Jugendlichen , Sachthemen |
| Erscheinungsjahr: | 2018 |
| Beschaffenheit: | Print Variante: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien *** Digitale Variante: komplettes Heft und CD Inhalte als Download sofort zur Verfügung (PDF, editierbares Word) |
| Seitenzahl: | 28 |
| Produktnummer: | 40-1806 |
29,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
In der politischen Bildung ist es unumstritten, dass es wichtig ist, Menschen einen Rahmen zu bieten, damit sie selbst ihre Urteilskompetenz stärken können. Ihre Schülerinnen und Schüler sollen im analytischen Sinn genauer hinsehen und ihre Werte, die sie im Urteil vertreten, offenlegen und begründen können. Sie sollen lernen, Entscheidungen nicht isoliert und monokausal zu betrachten, sondern Wechselwirkungen, die sich durch eine Entscheidung mit anderen Bereichen ergeben, zu beachten und bei der eigenen Urteilsbildung zu berücksichtigen. Um einem Urteil eine analytische Struktur zu geben, müssen die Jugendlichen außerdem mit Kriterien arbeiten.
- Im ersten Teil wird das politische Problem bearbeitet, das als Grundlage der Urteilsbildung dienen soll. Es geht um die Frage, ob der öffentliche Personennahverkehr in Zukunft kostenlos angeboten werden soll.
- Im zweiten Teil geht es darum, die Problemstellung zu bewerten.
- Im dritten Teil der Unterrichtsreihe müssen Schülerinnen und Schüler selbstständig ein anderes politisches Problem bewerten und dadurch ihre Urteilsbildung trainieren. Im Zentrum steht hier die Frage, ob Fahrverbote für Dieselfahrzeuge helfen, die Luftqualität zu verbessern und das Problem der hohen Emissionsbelastungen zu lösen.
Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe
1. Teil: Stau und schlechte Luft? Mobilität in deutschen Städten
- M 1.1 Das Problem: Autos, Autos, Autos
- M 1.2 Umweltbewusstsein in Deutschland
- M 1.3 Wie soll die Mobilität der Zukunft aussehen?
- M 1 E Problemanalyse
- M 1.4 Die Lösung: Ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr?
- M 1.5a Kontroverse Pro: Soll der öffentliche Nahverkehr kostenlos sein?
- M 1.5b Kontroverse Kontra: Soll der öffentliche Nahverkehr kostenlos sein?
- M 1.6 Entscheidung: Soll der öffentliche Nahverkehr kostenlos sein?
2. Teil: Politische Urteile fällen – wie geht das?
- M 2.1 Politische Probleme aus unterschiedlichen Perpektiven betrachten
- M 2.2 Bei einem Urteil Wechselwirkungen berücksichtigen
- M 2.3 Bei einem Urteil Wechselwirkungen berücksichtigen – Unterstützungshilfen
- M 2.4 Bei einem Urteil Kriterien anwenden
- M 2.5 Urteilskriterien im Überblick
- M 2.6 Bei einem Urteil Kriterien anwenden – Unterstützungshilfen
- M 2.7 Arbeitsblatt: Vorüberlegungen zum politischen Urteil
3. Teil: Freies Traing: Sollen Dieselfahrverbote erlassen werden?
- M 3.1 Karikatur: Wozu ein Dieselverbot?
- M 3.2 Ein politisches Urteil fällen: Sollen Dieselfahrverbote erlassen werden?
- M 3.3 Quellen der Luftbelastung
- M 3.4 Arbeitsblatt: Schritt für Schritt zum politischen Urteil
- M 3.A Klimapolitik: Müssen wir weniger Auto fahren?
- M 4.A Urteilen: Übung