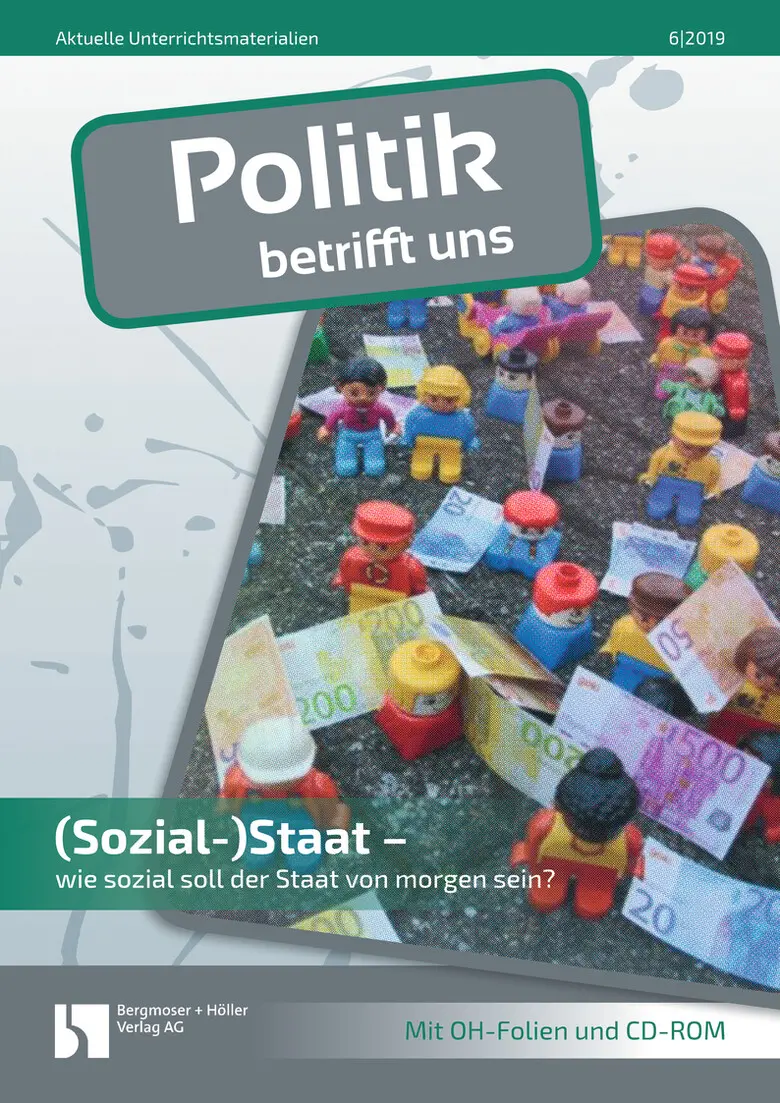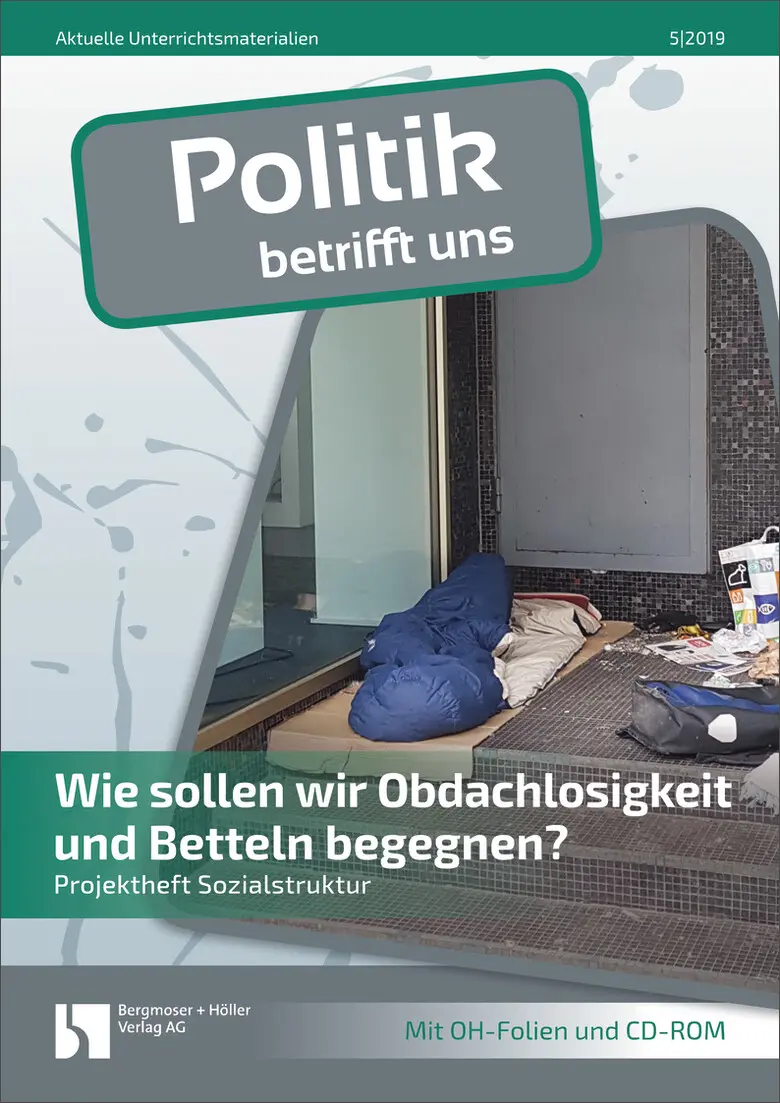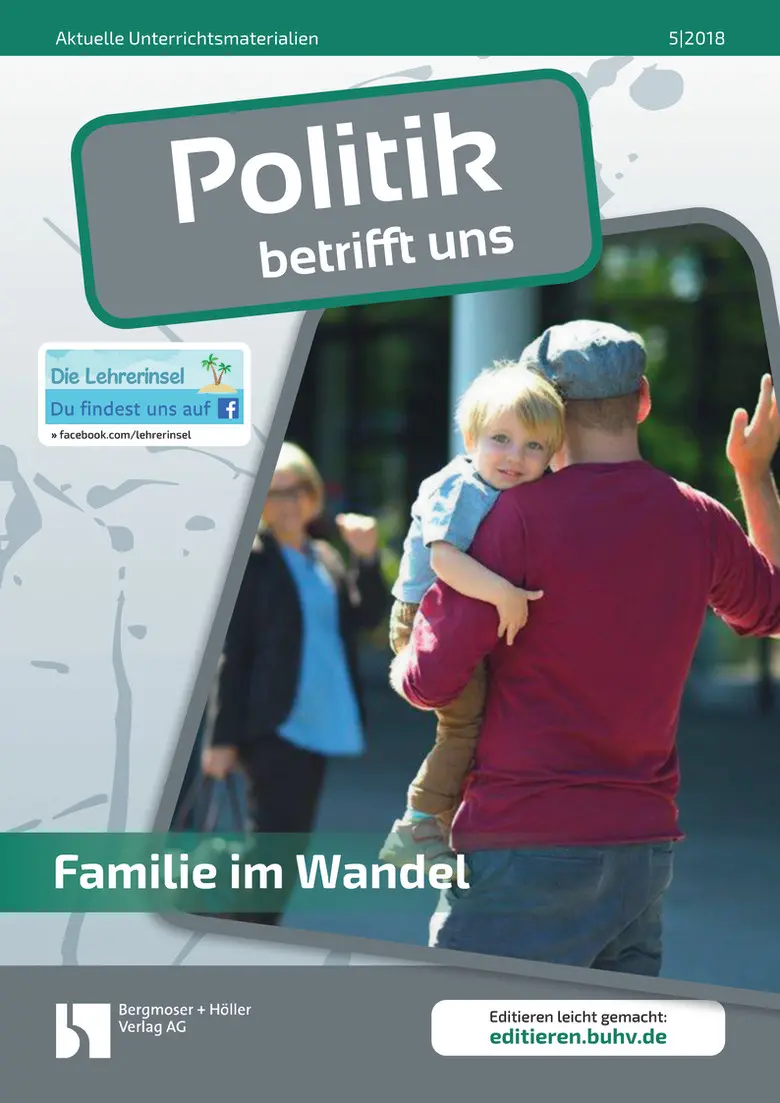(Sozial-)Staat
(Sozial-)Staat
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Lebenswelten von Jugendlichen , Sachthemen |
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
| Beschaffenheit: | Print Variante: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien *** Digitale Variante: komplettes Heft und CD Inhalte als Download sofort zur Verfügung (PDF, editierbares Word) |
| Seitenzahl: | 28 |
| Produktnummer: | 40-1906 |
29,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
Hinter dem Thema „(Sozial-)Staat“ verbergen sich sehr viel grundlegende Fragen:
Was ist überhaupt gerecht? Wie tickt der Mensch? Ist er von Natur aus kreativ und bestrebt, sich durch Arbeit zu verwirklichen,
oder legt er sich gern auf die „faule Haut“, wenn er nicht gezwungen ist zu arbeiten?
Im ersten Teil sollen die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Voreinstellung zum Sozialstaat reflektieren.
Im zweiten Teil wird die Frage aufgeworfen, ob das bedingungslose Grundeinkommen als höchste Stufe der sozialen Leistungen eine mögliche Antwort auf all die sozialstaatlichen Problem sein könnte,
die im ersten Teil gesammelt worden sind.
Im dritten Teil der vorliegenden Unterrichtseinheit ist die Lerngruppe der Notwendigkeit ausgeliefert, eine möglichst faire Verteilung der sozialstaatlichen Leistungen zu finden.
Die vorgeschlagenen realpolitischen Vorschläge müssen analysiert und beurteilt werden.
Der letzte Teil weist den größten Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler auf. Die Handlungskompetenz steht beispielsweise bei einer E-Mail Vordergrund,
die als persönliche Reaktion auf Felix Brandstätters Vorschlag des Deutschlandpraktikums formuliert werden soll.
Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe
1. Teil: Der Sozialstaat in Deutschland – bitte weiter so?
- M 1.1 Die Klärung einer Beziehung
- M 1.2 Der Sozialstaat – mehr als ein Schlagwort?
- M 1.3 Was die Menschen über ihren Sozialstaat denken
2. Teil: Das bedingungslose Grundeinkommen – die Lösung aller sozialstaatlichen Probleme?
- M 2.1 Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens für alle
- M 2.2 Die Parteien zum bedingungslosen Grundeinkommen Teil 1
- Die Parteien zum bedingungslosen Grundeinkommen Teil 2
- M 2.3 Die Wirtschaft zum bedingungslosen Grundeinkommen
- M 2.4 Der Blick über den Tellerrand – das bedingungslose Grundeinkommen im europäischen Ausland
- M 2.5 Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens – ein persönliches Zwischenfazit
3. Teil: Kleinere Brötchen – realpolitische Alternativen zum bedingungslosen Grundeinkommen
- M 3.1 Das Geld des Staates – wer soll was bekommen?
- M 3.2 Wenn nicht alle, wer dann? Was der Staat denken soll
- M 3.3 Karikatur: Die Grundrente
- M 3.4 Unterstützung für die, die schon etwas geleistet haben: die Rentengeneration
- M 3.4 E Fortsetzung des Interviews aus M 3.4
- M 3.5 Unterstützung für die, die sie nötig haben: die Bedürftigen
- M 3.6 Plakat: Bündnis für gebührenfreie Kitas in Baden-Württemberg
- M 3.7 Unterstützung für die, die etwas leisten werden: die Kinder
4. Teil: Kontrovers diskutiert – ein Deutschlandpraktikum?
- M 4.1 Die Idee des Deutschlandpraktikums
- M 4.2 Das Deutschlandpraktikum – ein fundiertes Urteil in Kategorien
- M 4.3 Klausurvorschlag
- M 4.3 A Das Deutschlandpraktikum: ein politischer Kommentar