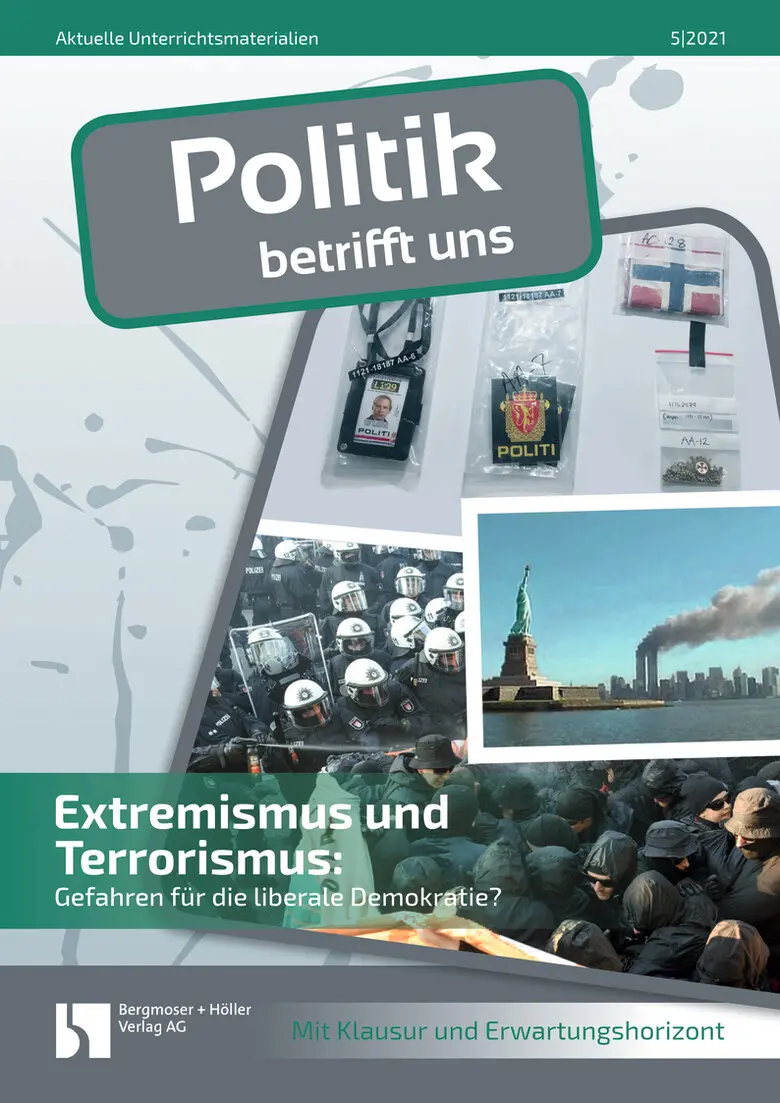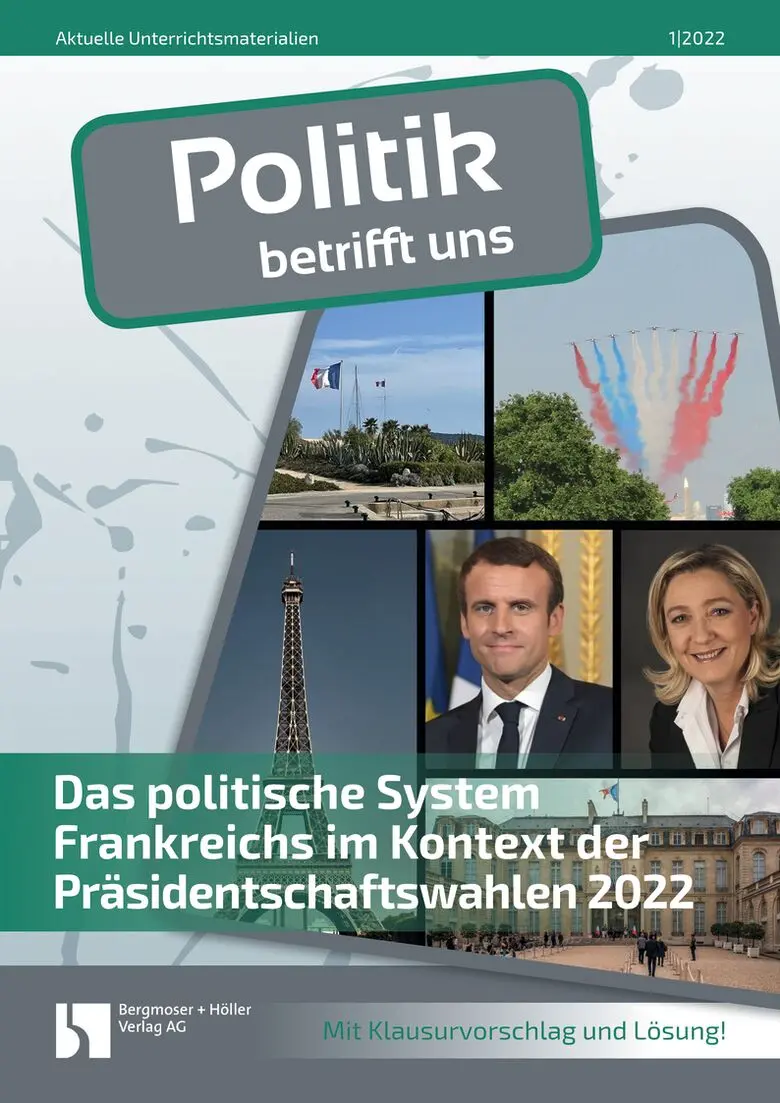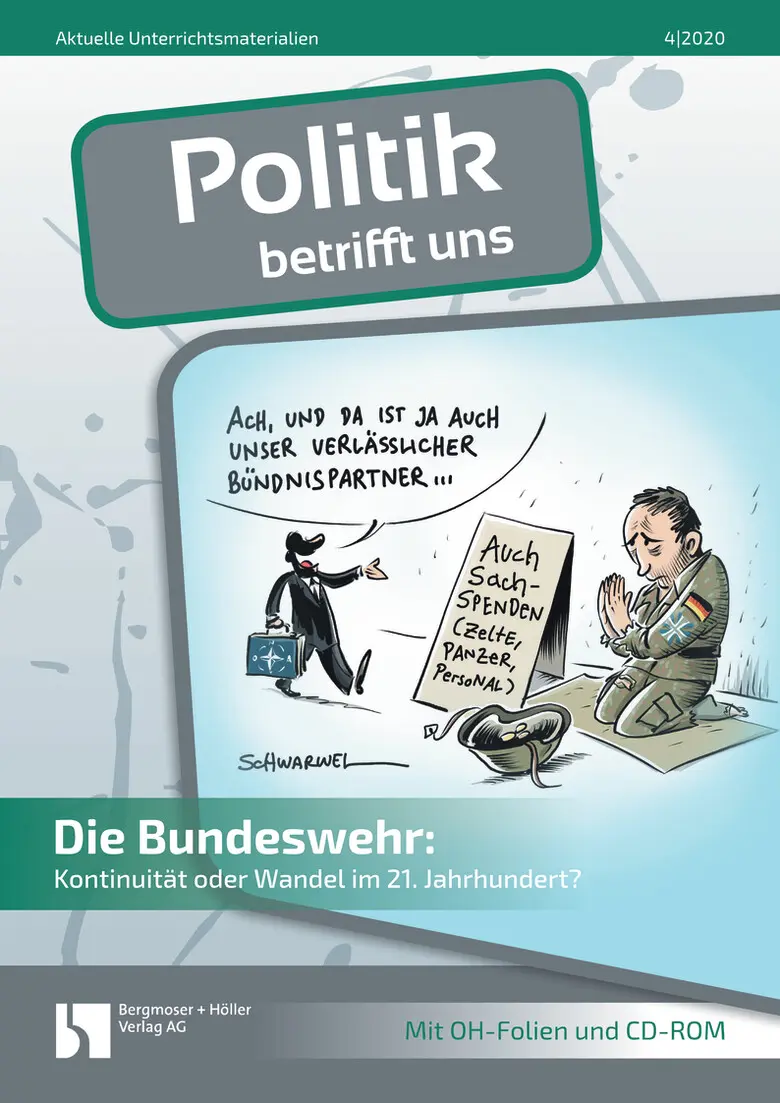Extremismus und Terrorismus:
Gefahren für die liberale Demokratie?
Extremismus und Terrorismus:
Gefahren für die liberale Demokratie?
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Ausland , Deutschland , Sachthemen |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
| Beschaffenheit: | Print: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbiger OH-Folien; Online: Heft (PDF und Word), Bilder (.jpg) |
| Seitenzahl: | 28 |
| Produktnummer: | 40-2105 |
Online
29,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
Produktinformationen "Extremismus und Terrorismus:"
Die vorliegende Unterrichtseinheit „Extremismus und Terrorismus" beleuchtet die Frage, ob Gefahren für die liberale Demokratie bestehen.
- Der erste Teil beschreibt phänomenübergreifend zentrale Entwicklungen des Terrorismus. Über den internationalen zum transnationalen Terrorismus erwerben die Schüler/-innen unter anderem Sachkenntnisse (Sachkompetenz) über den Formwandel, den der Terrorismus seit den 1960er-Jahren durchgemacht hat. Eingeleitet wird dieser erste Teil von einem Interview-Auszug mit Herrn Dr. Hedayat, der als Extremismusexperte des BKA tätig ist.
- Im zweiten Teil der Unterrichtsreihe erörtern die Schüler/-innen zum einen an Sachmaterialien Gründe, Motive und Ursachen der Hinwendung zu terroristischen Gruppierungen (Sach- und Analysekompetenz). Darüber hinaus werden die neuen Medien als ein zentraler Baustein der Rekrutierung vorgestellt, kritisch bewertet und beurteilt (Urteilskompetenz).
- Im dritten Teil der Unterrichtsreihe werden Bekämpfungs- und Präventionsstrategien gegen extremistische Bestrebungen thematisiert (Sachkompetenz). Dabei analysieren die Schüler/-innen vorwiegend Konzepte, die für Jugendliche gestaltet wurden. Den Abschluss der Reihe bildet eine für eine Doppelstunde konzipierte Klausur einschließlich möglichem Erwartungshorizont.
Ergänzt wird diese Unterrichtseinheit durch ein Aktuell zum Thema „Reichsbürger und Selbstverwalter".