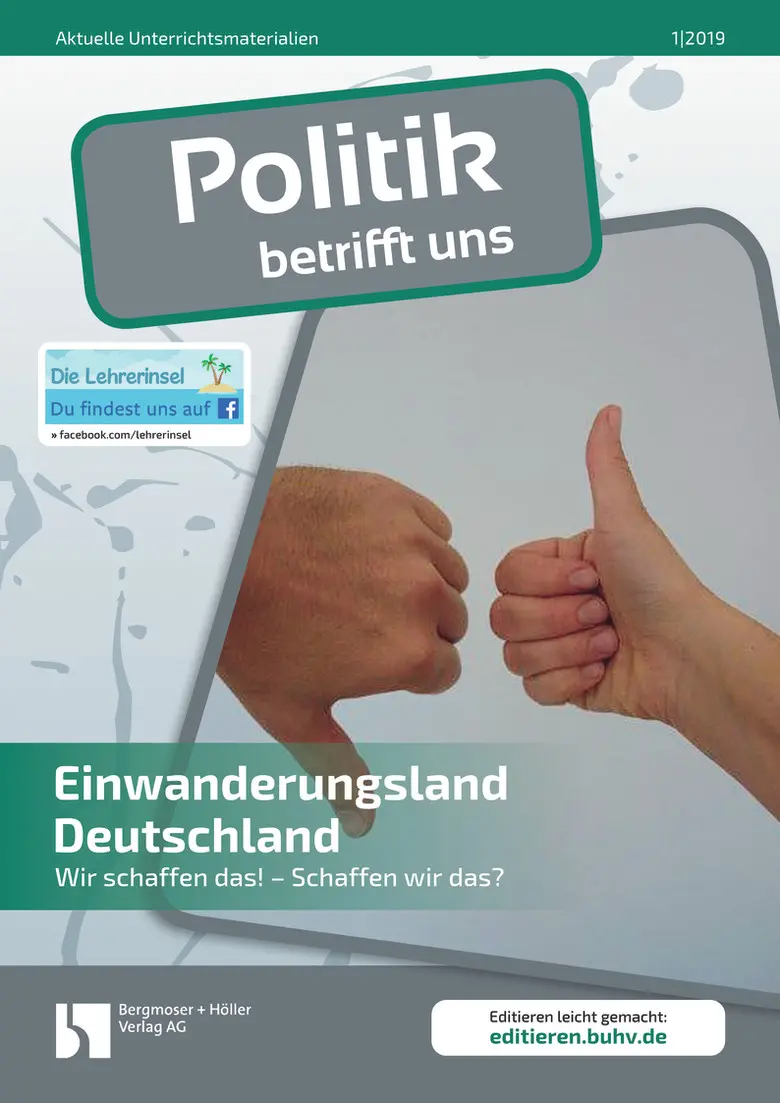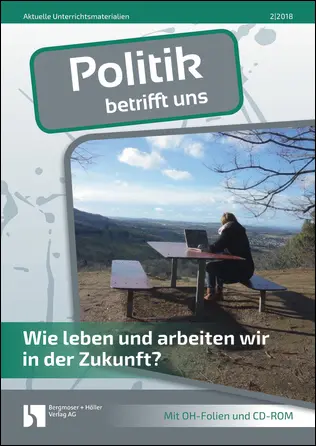Einwanderungsland Deutschland
Einwanderungsland Deutschland
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Ausland , Deutschland |
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
| Beschaffenheit: | Print Variante: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien *** Digitale Variante: komplettes Heft und CD Inhalte als Download sofort zur Verfügung (PDF, editierbares Word) |
| Seitenzahl: | 28 |
| Produktnummer: | 40-1901 |
29,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
„Wir schaffen das!" - Eines der bekanntesten Zitate von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hier geht es um die oft umstrittene Flüchtlingszuwanderung nach Deutschland. Ob uns die Integration gelungen ist und wie ein passendes Einwanderungsgesetz aussehen könnte, sollen die Schülerinnen und Schüler beurteilen und weiterdenken. Durch Diskussionen soll sich mit diesem Thema und dem Dilemma, dass einerseits der aktuelle Gesetzesentwurf intransparent sei und Deutschland andererseits auf Zuwanderer als Arbeitskräfte angewiesen ist, auseinandergesetzt und darüber geurteilt werden. Dazu wird die eigene Bewertungskompetenz der Jugendlichen systematisch, in vier aufeinander aufbauenden Teilen gefördert.
-
Im ersten Teil fragen die Lehrer nach den ersten Assoziationen der Schülerinnen und Schüler zur Einwanderung. Die Lernenden stellen verschiedene Daten und Fakten gegenüber.
- Im zweiten Teil nimmt die Lerngruppe unterschiedliche Perspektiven zur Integration ein, um diese ein wenig analysieren und beurteilen zu können.
- Im dritten Teil erweitern die Jugendlichen ihre Analyse- und Beurteilungskompetenz. Im Zentrum steht hier die Betrachtungsweise zum bestehenden Einwanderungsgesetz.
- Im vierten Teil thematisieren die Schülerinnen und Schülern schließlich den Vorschlag eines Integrationsforschers und verstärken dadurch ihr Urteilsvermögen umfassend.
Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe
1. Teil: Herzlich willkommen im Einwanderungsland Deutschland?
- M 1.1 Erste Annäherung: Einwanderungsland Deutschland Wir schaffen das! – Schaffen wir das?
- M 1.2 Herausforderung Einwanderung: 2015 bis heute
- M 1.3 Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland im Jahr 2017
- M 1.4 Einwanderungsland Deutschland: Zahlen und Fakten
2. Teil: Wir schaffen das: Dimensionen/Facetten der Integration
- M 2.1 Herausforderung Integration: Die Perspektive eines Karikaturisten FOLIE
- M 2.2 Herausforderung Integration: Die Perspektive eines Arbeitgebers – Interview
- M 2.3 Herausforderung Integration: Die Perspektive einer männlichen Privatperson – Interview
- M 2.4 Herausforderung Integration: Die Perspektive eines Integrationsbeauftragten – Interview
- M 2.5 Herausforderung Integration: Die Perspektive einer weiblichen Privatperson – Interview
- M 2.6 Recherche vor Ort zum Thema „Integration: Wir schaffen das!
- M 2 A Herausforderung Integration: Die Perspektive von Akteuren aus Politik und Gesellschaft vor Ort
3. Teil: Wie soll das neue deutsche Zuwanderungsgesetz gestaltet sein?
- M 3.1 Die Meinung Jugendlicher zum Thema Zuwanderungsgesetz
- M 3.2 Deutschland braucht ein neues Zuwanderungsgesetz!
- M 3.3 Blick über den Tellerrand: Das Einwanderungsgesetz von Kanada
- M 3.4 Blick über den Tellerrand: Das Einwanderungsgesetz von Australien
- M 3.5 Blick über den Tellerrand: Neues Asyl- und Einwanderungsgesetz von Frankreich
- M 3.6 Einwanderungsland Deutschland: So könnte ein neues Zuwanderungsgesetz aussehen
- M 3.E Auswertungsblatt: Zuwanderungsgesetze im Vergleich
4. Teil: Kontrovers diskutiert: Wir schaffen das! – Schaffen wir das?
- M 4.1 Wir schaffen das! – Schaffen wir das?
- M 4.2 Einwanderungsland Deutschland: „Wir leben nicht in Normalzeiten“
- K 4.3 Klausurvorschlag