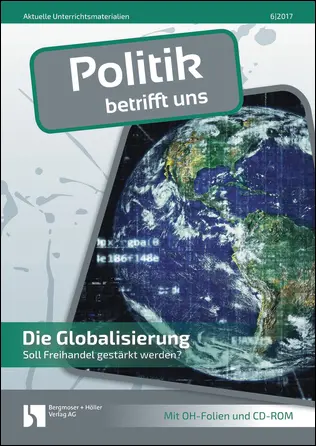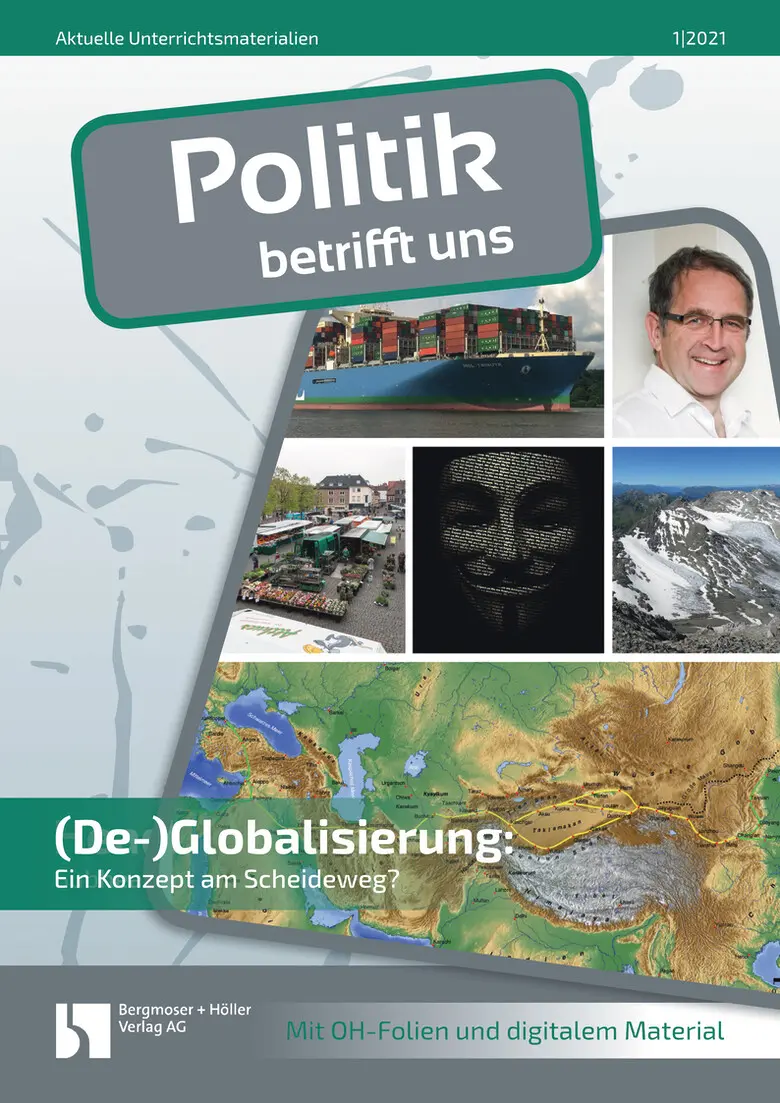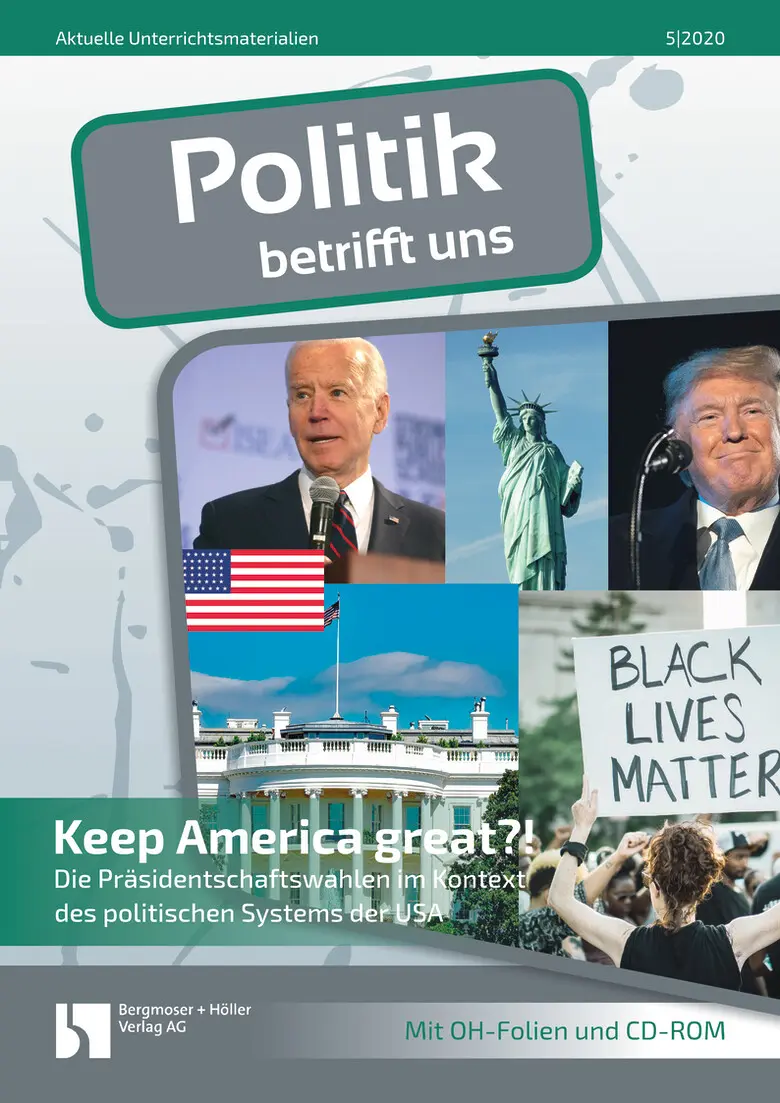Die Globalisierung
Soll Freihandel gestärkt werden?
Die Globalisierung
Soll Freihandel gestärkt werden?
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Sachthemen |
| Erscheinungsjahr: | 2017 |
| Beschaffenheit: | Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien |
| Seitenzahl: | 34 |
| Produktnummer: | 40-1706 |
Online
29,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
Produktinformationen "Die Globalisierung"
Lange Zeit teilten die Vertreter der führenden Industrienationen der Welt die Auffassung, dass der Freihandel die Grundlage für den Wohlstand der Nationen darstellt . Fast schon gebetsmühlenhaft wurde die Bedeutung des Freihandels in den Abschlusserklärungen der G7-Gipfeltreffen von den Staats- und Regierungschefs betont.
Um die Globalisierung und den Freihandel bewerten zu können, bedarf es eindeutiger Kriterien.
Die vorliegende Unterrichtseinheit zum Thema Globalisierung und Freihandel ist auf diesem Hintergrund in vier Teile gegliedert:
Die vorliegende Unterrichtseinheit zum Thema Globalisierung und Freihandel ist auf diesem Hintergrund in vier Teile gegliedert:
- Der erste Teil widmet sich der Frage, was die Globalisierung eigentlich ist und wie Staaten wirtschaftlich ihre Außenhandelspolitik gestalten können.
- Im zweiten Teil geht es darum zu klären, wer von der Globalisierung profitiert und wer nicht.
- Im dritten Teil der Unterrichtsreihe geht es um einen spannenden Konflikt: Wenn Freihandel tatsächlich zu mehr Wohlstand führt, warum funktioniert er dann nicht von ganz alleine?
- Auch der abschließende vierte Teil behandelt ein auf den ersten Blick unerklärliches Phänomen: Im Ausland erntet Deutschland für seine Exportstärke Kritik: Was kann an wirtschaftlicher Stärke schlecht sein?
Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe
1. Teil: Globalisierung – was ist das?
- M 1.1 Wie beeinflusst die Globalisierung unser Leben?
- M 1.2 Freihandel oder Protektionismus: Wie Staaten wirtschaftlich agieren
- M 1.3 Wie intensiv können Staaten wirtschaftlich kooperieren?
- M 1.4 Was treibt die internationale Arbeitsteilung voran?
- M 1.5 Brauchen wir andere, um unsere wirtschaftliche Lage zu verbessern?
- M 1.6 Wie kann man die Globalisierung theoretisch erklären?
2. Teil: Wem nützt die Globalisierung?
- M 2.1 Freier Handel – Garant für den Wohlstand der Nationen?
- M 2.2a Millenniumsziele: Armut, Bildung und Gesundheit der Menschen auf dieser Welt
- M 2.2b Millenniumsziele: Wie ökologisch nachhaltig ist die weltweite Entwicklung?
- M 2.2c Millenniumsziele: Wie ist der Zugang zu Märkten geregelt?
- M 2.2E Vorlage Gruppenpuzzle
- M 2.3 Die Millenniumsziele der Vereinten Nationen
- M 2.A Wie lässt sich Wohlstand messen?
3. Teil: Warum funktioniert Freihandel nicht von ganz alleine?
- M 3.1 Warum kooperieren Staaten in Wirtschaftsfragen nicht automatisch?
- M 3.2 Der Welthandel – ein Wohlfahrtsdilemma?
- M 3.3 Die WTO: Welche Bedeutung hat sie für den internationalen Handel?
4. Teil: Deutschlands Exporte – Kann Erfolg ein Problem sein?
- M 4.1 Immer mehr exportieren! Auf Dauer eine gute Idee? Darstellung im Wirtschaftskreislauf
- M 4.2 Was passiert, wenn man den eigenen Markt für andere öffnet?
- M 4.3 Bringt die Exportbilanz Deutschland in Gefahr?
- M 4.4 Karikatur: Mauert sich Deutschland ökonomisch ein?