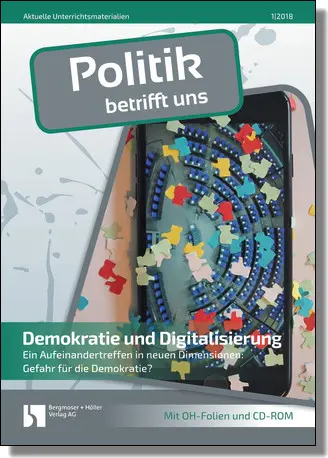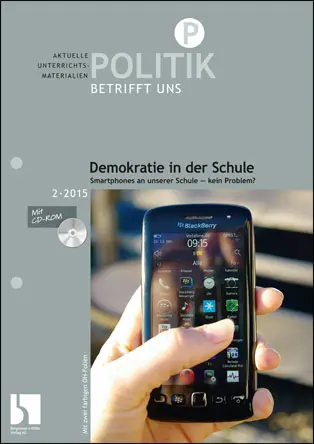Demokratie und Digitalisierung
Demokratie und Digitalisierung
| Hersteller: | Bergmoser + Höller Verlag AG |
|---|---|
| Reihe: | MEIN FACH - Politik Sek II |
| Themengebiet: | Demokratie |
| Erscheinungsjahr: | 2018 |
| Beschaffenheit: | Print Variante: Heft, DIN A4, perforiert, 28 Seiten, inkl. 2 farbige OH-Folien *** Digitale Variante: komplettes Heft und CD Inhalte als Download sofort zur Verfügung (PDF, editierbares Word) |
| Produktnummer: | 40-1801 |
29,90 €
0,00 €
inkl. MwSt.
Verfügbar
Versandkostenfrei
Die im 5. Jahrhundert v. Chr. gegründeten Stadtstaaten sind früheste Beispiele der demokratischen Idee, welche natürlich seit den frühesten Anfängen einem steten Wandel unterworfen ist. Die charakteristischen Merkmale wie beispielsweise die Grund-, Bürger- und Menschenrechte, Meinungsfreiheit und das Mehrheits- bzw. Konsensprinzip führen nachweislich zu einer höheren Zufriedenheit im Leben der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Das Gefühl, Teil des Ganzen zu sein, mitreden und mitwirken zu können, ist wesentlich für den gesellschaftlichen Frieden. Genau dieser Ansatz erklärt auch die in hohem Maße steigende Nutzerzahl von Social Media. Die vorliegende Unterrichtseinheit zum Thema Demokratie und Digitalisierung gliedert sich in vier Teile.
- Nach einer schülernahen Annäherung an das Thema im ersten Teil, behandelt der zweite Teil den Begriff "Demokratie". Die Schüler/-innen lernen hier auch die Form der repräsentativen Demokratie kennen.
- Im dritten Teil der Unterrichtsreihe geht es um die Digitalisierung inklusive der Analyse einer individuellen Nutzung.
- Der abschließende vierte Teil konzentriert sich nun auf das Aufeinandertreffen von Demokratie und Digitalisierung. Die Lerngruppe untersucht umfassend den Einfluss von Social Media auf Meinungsbildungsprozesse.
- Am Ende der Unterrichtseinheit folgt eine Auseinandersetzung mit den Gefahren von Cyber-Attacken.
Inhaltsverzeichnis aktuelle Ausgabe
1. Teil: Demokratie und Digitalisierung im Alltag
- M 1.1 Demokratie und Digitalisierung
- M 1.2 Demokratie – was bedeutet das für mich?
- M 1.3 Demokratie – in „meinem“ digitalen Raum vertreten?
2. Teil: Demokratie
- M 2.1 Demokratie – Annäherung an eine Definition
- M 2.2 Repräsentative Demokratie
- M 2.3 Warum Demokratie?
3. Teil: Digitalisierung
- M 3.1 Was ist Digitalisierung?
- M 3.2 Digitalisierung – Überschneidungen des Privaten mit dem politischen Rahmen
- M 3.3 Digitalisierung – die Bandbreite der Bereiche
4. Teil: Demokratie trifft Digitalisierung
- M 4.1 Operator „beurteilen“
- M 4.2 Einfluss sozialer Medien auf Meinungsbildungsprozesse – Teil 1
- M 4.2E Meinungsbildung / Urteilen
- M 4.3 Einfluss sozialer Medien auf Meinungsbildungsprozesse – Teil 2
- M 4.4 Einfluss sozialer Medien auf Meinungsbildungsprozesse – Teil 3
- M 4.5 Säulendiagramm: Facebook-Abonnenten der Parteien
- M 4.6 Digitalisierung ausgenutzt? Donald Trump und die sozialen Medien
- M 4.7 Karikatur: Digitalgipfel
- M 4.7E Erstellung einer Karikatur
- M 4.8 Digitalisierung genutzt: Digitales Vorzeigeland Estland – übertragbares Modell?
- M 4.9 Ist durch die Digitalisierung das demokratische System in Gefahr?
- M 4.10 Eine Karikatur selbst erstellen